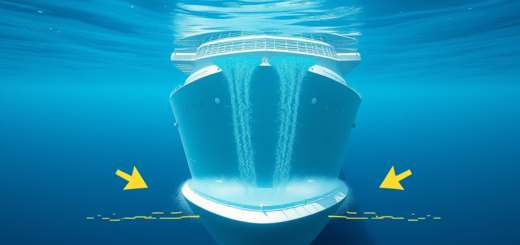von Walter Schrader · 8. Februar 2025
Warum werden Schiffe „sie“ genannt?

Schon einmal darüber nachgedacht, warum wir in der deutschen Sprache Schiffe oft mit weiblichen Bezeichnungen benennen oder warum viele Schiffe Frauennamen tragen? Dieser Brauch ist in der Schifffahrtswelt tief verwurzelt und mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, doch er hat eine lange, teils mythische und kulturelle Geschichte.
Wenn du dich jemals gefragt hast, woher diese Tradition stammt, weshalb sie sich über Jahrhunderte hinweg gehalten hat oder ob sie überhaupt noch zeitgemäß ist, findest du hier die Antworten.
In diesem Artikel erfährst du:
- Wieso werden Schiffe „sie“ genannt?
- Historische Verbindungen zu weiblichen Gottheiten
- Schutz, Mutterrolle und Anthropomorphismus
- Seefahrt-Traditionen: Warum sich die Sitte weiterträgt
- Theorien mit geringerem Einfluss
- Moderne Kontroversen: Ist das noch zeitgemäß?
- Betrifft es auch Kreuzfahrtschiffe?
- Fazit
Die Hintergründe dieser weiblichen Anrede
Die maritime Welt hat ihre ganz eigenen Bräuche und Geschichten – dazu gehört auch, dass Schiffe oft als „sie“ bezeichnet werden. Doch wie kam es zu dieser tief verwurzelten Tradition? Es existiert nicht nur eine einzige Erklärung. Vielmehr haben sich über die Jahrhunderte unterschiedliche Einflüsse vermischt, die zusammen erklären, warum wir auch heute noch von „ihr“ sprechen, wenn wir über ein Schiff reden.
Ein Grund liegt darin, dass die Seefahrt über Jahrhunderte eine Männerdomäne war. Für viele Kapitäne und Matrosen war das Schiff eine Art schützende, fürsorgliche Figur, die ihnen Unterschlupf bot und sie sicher über die Ozeane brachte. Andere verorten die Wurzeln dieser Gewohnheit bei antiken Göttinnen der See. Wieder andere betonen sprachliche Traditionen aus dem Lateinischen oder heben den eleganten Charakter hervor, den ein Schiff besitzen soll – ähnlich den klassischen Vorstellungen von Weiblichkeit.
Historische Verbindungen zu weiblichen Gottheiten
In zahlreichen alten Kulturen gab es Meeresgöttinnen und weibliche Schutzpatroninnen für die Schifffahrt. In der griechischen Mythologie ist das beispielsweise Aphrodite, während die Römer Venus verehrten. Diese Göttinnen waren nicht nur für Schönheit und Liebe zuständig, sondern galten auch als Glücksbringerinnen und Beschützerinnen auf See.
Damit ein Schiff sicher in See stechen konnte, brachte man es gerne mit solchen göttlichen Figuren in Verbindung. Wer den Segen einer starken Meeresgöttin hatte, konnte auf ruhige Fahrten und sichere Heimkehr hoffen. In vielen Kulturen entwickelte sich daraus die Sitte, Schiffen Frauennamen zu geben und im Alltag von „ihr“ zu sprechen.
Schutz, Mutterrolle und Anthropomorphismus
Neben religiösen Einflüssen spielt die Vermenschlichung von Gegenständen eine große Rolle – auch „Anthropomorphismus“ genannt. Schiffe werden dabei so behandelt, als hätten sie menschliche Eigenschaften. Für viele Seeleute galten sie als mütterliche Beschützerinnen, die ihnen Obdach, Nahrung und Sicherheit schenkten, während sie monatelang fernab ihrer Heimat unterwegs waren.
Besonders in Zeiten, als die Schifffahrt extrem gefährlich war, lag es nahe, das Schiff als weiblichen Schutzraum zu personifizieren: einen Ort, an dem man sich geborgen fühlen konnte, wenn draußen die rauen Wellen tobten. Dieses Gefühl wurde oft noch verstärkt, indem Schiffe nach wichtigen Frauen im Leben der Seeleute benannt wurden, sei es die Geliebte, Ehefrau, Mutter oder sogar namhafte historische Persönlichkeiten wie Königinnen oder Herzoginnen.
Seefahrt-Traditionen: Warum sich die Sitte weiterträgt
Wenn du schon einmal längere Zeit unter Seeleuten verbracht hast, weißt du wahrscheinlich, dass kaum eine Branche so viele Bräuche und Traditionen pflegt wie die Schifffahrt. Ob es um Rangabzeichen, Begrüßungsrituale oder den Taufspruch für ein neues Schiff geht: Aberglaube und Traditionsbewusstsein sind Teil des Alltags.
Auch das konsequente Verwenden weiblicher Artikel und das Geben von Frauennamen für Schiffe gehören in diesen Bereich. Zwar gibt es aus moderner Sicht manchmal keine eindeutige oder aktuelle Begründung mehr – aber Traditionen halten sich oft über Jahrhunderte. Diese Mund-zu-Mund-Weitergabe führt dazu, dass Schiffe heute noch sehr häufig im Femininum angesprochen werden.
Theorien mit geringerem Einfluss
Manche Erklärungsansätze sind eher im Bereich der Spekulation anzusiedeln. Oft hört man zum Beispiel, dass sich der Begriff „Schiff“ von lateinischen Wörtern ableitet, die weiblich konnotiert sind („navis“). Allerdings ist das nur bedingt stichhaltig, da in anderen romanischen Sprachen Schiffe durchaus männliche Artikel verwenden.
Ebenso werden häufig weibliche Eigenschaften wie „Grazie“ oder „Eleganz“ angeführt, um zu erklären, weshalb man ein Schiff mit einer Frau vergleicht. Zwar ist dies eine charmante Idee, doch es scheint wahrscheinlicher, dass kultische und symbolische Bedeutungen einen größeren Einfluss hatten als rein romantisierte Vorstellungen von Weiblichkeit.
Moderne Kontroversen: Ist das noch zeitgemäß?
In den letzten Jahrzehnten stellt sich immer wieder die Frage, ob die durchweg weibliche Sprechweise bei Schiffen nicht ein überholtes Relikt ist, das veraltete Rollenbilder reproduziert. Während traditionelle Maritimeinrichtungen an dieser Gewohnheit festhalten, gibt es auch Stimmen, die für geschlechtsneutrale Formulierungen plädieren.
Manche argumentieren, dass das ständige „Sie“ für ein Schiff Frauen zu einer Art Objekt mache und Klischees über Pflege- und Schutzrollen verstärke. Andere betonen, dass es sich lediglich um eine lang gelebte Praxis handelt, die nicht zwingend geschlechtsdiskriminierend sein muss.
Einige Reedereien gehen mittlerweile einen Mittelweg: Obwohl ihre Schiffe weiterhin Frauennamen tragen, verwenden sie in offiziellen Texten geschlechtsneutrale Bezeichnungen. Ob sich diese Perspektive in Zukunft durchsetzen wird, ist unklar – die Seefahrt ist bekannt dafür, ihre alten Traditionen nur langsam aufzugeben.
Betrifft es auch Kreuzfahrtschiffe?
Gerade in der Welt der Kreuzfahrten wirst du feststellen, dass viele Schiffe noch immer Frauennamen tragen und nach wie vor im Femininum angesprochen werden. Denke etwa an die Queen Mary 2 oder zahlreiche AIDA-Schiffe wie AIDAstella oder AIDAsol, die zwar nicht direkt „Frauennamen“ sind, aber doch eindeutig weiblich konnotiert klingen.
Beispiele:
- Mein Schiff Flotte (TUI Cruises): Diese Schiffe tragen keine klassischen Frauennamen, werden aber im Alltag oft als „sie“ oder „ihr“ bezeichnet.
- Costa-Schiffe: Viele ältere Modelle hießen zum Beispiel Costa Allegra oder Costa Marina, was ebenfalls im Weiblichen verankert ist.
Moderne Reedereien probieren mitunter auch abstraktere Namen aus, die nicht unbedingt wie Frauenvornamen klingen. Dennoch bleibt das Femininum an Bord meist bestehen. In deutschen Pressemitteilungen heißt es weiterhin „die AIDAnova“ oder „die MSC Virtuosa“.
Ob das so bleibt oder ob zukünftig neutralere Bezeichnungen überwiegen werden, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass die maritime Tradition tief verankert ist – und viele Stammgäste genau diesen Hauch von Geschichte und Romantik zu schätzen wissen.
Fazit
Ob aus Respekt vor Meeresgöttinnen, in Gedenken an geliebte Frauen oder durch tief verwurzelten seefahrerischen Aberglauben – Schiffe als „sie“ anzusprechen, ist ein Brauch, der sich über Jahrhunderte gehalten hat. In der traditionsträchtigen Seefahrt hat sich diese Angewohnheit so stark verankert, dass moderne Sprachdebatten bislang wenig daran ändern konnten.
Am Ende entscheidet jeder selbst, wie er ein Schiff bezeichnet. Wer an der Tradition festhalten will, spricht von „der“ oder „ihr“ und gibt dem Schiff einen Frauennamen. Wer moderner an die Sache herangehen möchte, kann hingegen eine neutrale Variante wählen. Eines steht fest: In diesem Sprachgebrauch liegt viel Geschichte und Kultur, die das Seefahrerleben geprägt haben.
Ob du mit dem Gedanken spielst, selbst eine Kreuzfahrt zu machen oder einfach nur am maritimen Brauchtum interessiert bist – das Thema bleibt faszinierend und zeigt, wie eng Sprache, Kultur und Glaube miteinander verwoben sind. Solange Schiffe über die Weltmeere fahren, wird sich wahrscheinlich auch in Zukunft die Frage stellen, ob wir weiterhin „sie“ sagen oder doch irgendwann ein Umdenken erfolgt.